Disclaimer: New EUDR developments - December 2025
In November 2025, the European Parliament and Council backed key changes to the EU Deforestation Regulation (EUDR), including a 12‑month enforcement delay and simplified obligations based on company size and supply chain role.
Key changes proposed:
These updates are not yet legally binding. A final text will be confirmed through trilogue negotiations and formal publication in the EU’s Official Journal. Until then, the current EUDR regulation and deadlines remain in force.
We continue to monitor developments and will update all guidance as the final law is adopted.
Die internationale Nachhaltigkeitsberichterstattung tritt in eine neue Ära ein. Mit Investoren und Regulierungsbehörden, die auf konsistente, vergleichbare Offenlegungen drängen, blicken Unternehmen weltweit auf die ISSB-Standards als globalen Maßstab.
Tatsächlich haben Gerichtsbarkeiten, die über die Hälfte der Weltwirtschaft repräsentieren, bereits Pläne angekündigt, die ISSB-Standards zu nutzen oder sich an ihnen auszurichten. Dies spiegelt den wachsenden Druck auf Unternehmen wider, darüber zu berichten, wie Nachhaltigkeitsfragen ihr Geschäft beeinflussen – von Klimarisiken bis hin zu sozialen und Governance-Herausforderungen.
Das ISSB (International Sustainability Standards Board) unter der IFRS-Stiftung hat seine ersten beiden Standards (IFRS S1 und IFRS S2) veröffentlicht, die ab 2024 wirksam sind und einen Rahmen für investorenorientierte Nachhaltigkeitsberichterstattung bieten.
Diese Standards sollen Investoren die „konsistente, vollständige, vergleichbare“ Information liefern, die sie benötigen, um die mit Nachhaltigkeit verbundenen Risiken und Chancen von Unternehmen über kurze, mittlere und lange Frist zu bewerten.
Wie sollte ein Unternehmen ISSB-Berichterstattung praktisch angehen? Wir haben einen Leitfaden erstellt, der auf zehn Kernschritten basiert – von der Identifizierung relevanter Risiken bis zur Vorbereitung auf die Prüfung – um eine ISSB-konforme Nachhaltigkeitsberichterstattung umzusetzen.
Jeder Schritt umfasst wichtige Aktivitäten, häufige Herausforderungen und praktische Tipps. Während der Fokus auf dem investorenorientierten Ansatz des ISSB liegt, werden wir, wo nützlich, auf Übereinstimmungen mit anderen Rahmenwerken (wie SASB, TCFD oder ESRS) hinweisen. Folgen Sie diesen Schritten, um IFRS S1 (Allgemeine Anforderungen) und IFRS S2 (Klima) strukturiert und überschaubar zu navigieren.

Die Grundlage der ISSB-Berichterstattung ist eine umfassende Bewertung von Nachhaltigkeitsrisiken und -chancen (R&O). Erfassen Sie alle Nachhaltigkeitsrisiken und -chancen, die den Unternehmenswert vernünftigerweise beeinflussen könnten.
Zum Beispiel bieten die SASB-Industrienormen eine Materialitätskarte wahrscheinlicher Themen nach Sektor, und Sie können Berichte von Wettbewerbern oder wissenschaftliche Forschung für sektorspezifische Einblicke prüfen. Wenn Ihr Unternehmen eine doppelte Materialitätsbewertung für die ESRS-Berichterstattung durchgeführt hat, können Sie die identifizierten Themen erneut nutzen – jetzt mit Fokus auf die „Outside-in“-finanziellen Auswirkungen.
Berücksichtigen Sie für jedes Nachhaltigkeitsthema (Klimawandel, Ressourcenknappheit, Belegschaft usw.), wie es sich auf die Cashflows Ihres Unternehmens, den Zugang zu Finanzierungen oder die Kapitalkosten auswirken könnte. IFRS S1 definiert nachhaltigkeitsbezogene Risiken und Chancen als solche, die die Aussichten des Unternehmens (Unternehmenswert) über kurze, mittlere oder lange Frist beeinflussen könnten. Achten Sie darauf, verschiedene Zeithorizonte zu berücksichtigen, wie es ISSB erfordert – zum Beispiel könnte ein Klimarisiko in diesem Jahr (kurzfristig) minimal, aber in 5+ Jahren (mittel-/langfristig) erheblich sein. Erfassen Sie diese Zeitrahmen in Ihrer Bewertung.
Beteiligen Sie funktionsübergreifende Experten (Nachhaltigkeit, Betrieb, Finanzen usw.), um relevante R&Os zu erarbeiten. Achten Sie darauf, sowohl Risiken (potenzielle negative Auswirkungen auf Ihr Geschäft) als auch Chancen (potenzieller Vorteil oder Wettbewerbsvorteil durch Nachhaltigkeitsentwicklungen) einzubeziehen.
Halten Sie den Umfang zunächst breit – es ist besser, mit einer langen Liste zu beginnen. Wenn Ihre Branche bekannte Umwelt- oder soziale Herausforderungen hat (z. B. Wasserverbrauch im Bergbau, Arbeitsbedingungen in der Fertigung), sollten Sie diese einbeziehen. Dieser Schritt führt oft zu einer „Risikoregister“-Tabelle, die jedes Thema mit Beschreibungen und Referenzen (wie SASB-Code oder ESRS-Referenz) zur einfachen Nachverfolgung auflistet.
Mit einem Universum potenzieller Nachhaltigkeitsthemen identifiziert, besteht der nächste Schritt darin, die Wesentlichkeit zu bestimmen – mit anderen Worten, welche Themen wirklich eine Offenlegung gegenüber Investoren verdienen. ISSB verwendet eine Unternehmenswertperspektive (oft als einfache Wesentlichkeit bezeichnet): Ein Punkt ist wesentlich, wenn das Weglassen oder Falschdarstellen vernünftigerweise die Entscheidungen von Investoren beeinflussen könnte. Ein einfacher Test ist: „Würde ein vernünftiger Investor seine Meinung über das Unternehmen ändern, wenn er von diesem Risiko oder dieser Chance wüsste?“ Wenn die Antwort ja lautet, ist das Thema wahrscheinlich wesentlich und sollte offengelegt werden; wenn nein, kann es weggelassen werden, um Unübersichtlichkeit zu vermeiden.
Berücksichtigen Sie die Art und das Ausmaß jedes Risikos oder jeder Chance und die Wahrscheinlichkeit, dass es Ihr Geschäft beeinflusst. Themen können aufgrund des Ausmaßes (z. B. ein potenziell großer finanzieller Einfluss) oder der Art (z. B. im Zusammenhang mit der Kernstrategie oder den Werten) oder einer Kombination wesentlich sein.
Seien Sie unternehmensspezifisch – konzentrieren Sie sich auf das, was angesichts der Umstände Ihres Unternehmens wichtig ist, nicht auf allgemeine Nachhaltigkeitsthemen. ISSB erwartet prägnante Offenlegungen, die auf Ihr Unternehmen zugeschnitten sind, und warnt ausdrücklich vor der Überoffenlegung unwesentlicher Informationen, die das Wesentliche verschleiern könnten.
Dokumentieren Sie die Begründung für jedes Wesentlichkeitsurteil. Zum Beispiel: „Wassermangelrisiko – wesentlich aufgrund der potenziellen Störung von 30 % der Produktion in unserer Schlüsselregion“ oder „Gemeinschaftsbeziehungen – nicht wesentlich (unsere Betriebe befinden sich in risikoarmen Gebieten)“.
Dies hilft beim Erstellen des Berichts und falls Prüfer oder Stakeholder nachfragen. Es ist auch nützlich, hier die Geschäftsleitung einzubeziehen – Wesentlichkeitsentscheidungen erfordern oft Urteile über die strategische Bedeutung. Wenn Sie unter mehreren Rahmenwerken arbeiten, denken Sie daran, dass die Wesentlichkeit des ISSB finanziell ausgerichtet ist. (Im Gegensatz dazu müssen Sie unter der EU-ESRS auch Auswirkungen auf Gesellschaft und Umwelt berücksichtigen – ein doppelter Wesentlichkeitsansatz.
Unternehmen, die beides tun, können die Prozesse ausrichten, indem sie alle Themen identifizieren und dann den finanziellen Wesentlichkeitsfilter für ISSB anwenden. Das Ergebnis dieses Schritts ist eine Liste wesentlicher Nachhaltigkeitsthemen (Risiken/Chancen), die den Fokus Ihres ISSB-konformen Berichts bilden werden.
Die ISSB-Berichterstattung ist nicht nur eine Checkliste von Risiken – sie erfordert die Erklärung, wie diese Risiken und Chancen Ihr Geschäft und Ihre Strategie beeinflussen. Schritt 3 besteht darin, jedes wesentliche R&O in Ihr strategisches Denken einzubetten.
Die IFRS-Standards fordern ausdrücklich von Unternehmen, die Auswirkungen jedes wesentlichen Risikos oder jeder Chance auf „das Geschäftsmodell und die Wertschöpfungskette des Unternehmens; die Strategie und Entscheidungsfindung des Unternehmens; und seine Ressourcenallokation und Kapitalverwendung“ offenzulegen. Mit anderen Worten, wie verändert Nachhaltigkeit, was Ihr Unternehmen tut, wie Sie es tun und wohin Sie Ressourcen lenken?
Beginnen Sie damit, zu untersuchen, wie jedes wesentliche Risiko oder jede Chance Ihr Geschäftsmodell und Ihre Wertschöpfungskette beeinflusst. Zum Beispiel, wenn der Klimawandel ein wesentliches Risiko darstellt, führt er zu Änderungen wie der Nutzung erneuerbarer Energien, der Neugestaltung von Produkten oder der Verlagerung von Einrichtungen? Wenn die Vielfalt der Belegschaft ein wesentliches Thema ist, überlegen Sie, wie es Ihre Talentstrategie oder Wertschöpfung beeinflusst.
Bewerten Sie als Nächstes, ob diese Themen Ihre gesamte Unternehmensstrategie oder wichtige Entscheidungen prägen. Zum Beispiel, führen klimabezogene Risiken zu einer Verschiebung hin zu kohlenstoffarmen Produkten? Werden diese Risiken auf Vorstandsebene diskutiert, was zu neuen Richtlinien oder Initiativen führt? Erfassen Sie, wie Nachhaltigkeitsüberlegungen Richtung und Governance beeinflussen.
Verbinden Sie dann jedes wesentliche Thema mit der Ressourcenallokation. Die ISSB-Berichterstattung erfordert, zu zeigen, wie Nachhaltigkeit in die Finanzplanung eingebettet ist. Zum Beispiel, wenn die Kreislaufwirtschaft eine Chance darstellt, haben Sie in neue Recyclinganlagen investiert? Wenn die Einhaltung von Vorschriften ein Risiko ist, finanzieren Sie Systeme oder Schulungen, um es zu adressieren? Dies zeigt, dass Nachhaltigkeit in Ihre Investitions- und Budgetentscheidungen integriert ist.
Dieser Schritt hebt oft Lücken hervor – Bereiche, in denen ein wesentliches Thema keine klare strategische Antwort oder Ressourcen hat. Behandeln Sie dies als Signal für Managementmaßnahmen. Binden Sie Strategie- und Finanzteams frühzeitig ein, um die Ausrichtung im gesamten Unternehmen sicherzustellen.
Wo möglich, verknüpfen Sie jedes Risiko mit bestehenden Strategien oder Zielen, wie z. B. die Verbindung von Klimarisiken mit Ihrer Klimastrategie oder Mission. Diese Eingaben fließen direkt in den „Strategie“-Abschnitt Ihres ISSB-Berichts ein, sammeln Sie also klare, spezifische Beispiele. Offenlegungen sollten nicht nur Ihre aktuelle Strategie widerspiegeln, sondern auch, wie sie sich entwickeln wird.
Für klimabezogene Risiken und Chancen legt ISSB (über IFRS S2) besonderen Wert auf Klimaresilienz. Unternehmen werden erwartet, zu bewerten, wie widerstandsfähig ihre Strategie angesichts verschiedener Klimaszenarien ist. Beachten Sie, dass dieser Schritt wahrscheinlich der komplexeste ist.
In der Praxis bedeutet dies, eine Klimaszenarioanalyse durchzuführen – eine Übung, bei der Sie Ihr Geschäft unter mindestens ein paar plausiblen zukünftigen Klimaergebnissen bewerten. Typischerweise würden Sie ein Szenario unter 2°C (im Einklang mit den Zielen des Pariser Abkommens, z. B. ein 1,5°C-Szenario) und ein höheres Emissionsszenario (z. B. 3°C+ bis Ende des Jahrhunderts) einbeziehen.
Das Ziel ist es, Ihre Strategie sowohl gegen eine aggressive Klimapolitikwelt als auch gegen eine Business-as-usual-Welt zu testen, um zu sehen, ob Sie Risiken wie physische Klimaauswirkungen oder Übergangskosten standhalten.
Beginnen Sie mit der Auswahl von mindestens zwei plausiblen Klimaszenarien. Eines sollte eine Zukunft mit niedriger Erwärmung darstellen (wie ein 1,5°C- oder unter 2°C-Szenario, im Einklang mit dem Pariser Abkommen), und ein anderes sollte eine Zukunft mit hoher Erwärmung darstellen (wie ein 3°C- oder 4°C-Szenario). Dies hilft zu bewerten, wie Ihr Geschäft unter sowohl aggressiven Klimapolitik- als auch Business-as-usual-Bedingungen abschneiden könnte.
Identifizieren Sie für jedes Szenario die wichtigsten Annahmen und Variablen. In Szenarien mit niedriger Erwärmung berücksichtigen Sie Faktoren wie steigende Kohlenstoffpreise, zunehmende Einführung sauberer Technologien und strengere Regulierung. In Szenarien mit hoher Erwärmung betrachten Sie häufigere extreme Wetterereignisse und Lieferkettenrisiken. Bewerten Sie, wie sich diese auf Ihre Betriebsabläufe, Kosten, Einnahmen und Marktchancen auswirken. Wo möglich, quantifizieren Sie die Auswirkungen – zum Beispiel die Identifizierung von Anlagen, die Wasserstress ausgesetzt sind, oder die Prognose von Kohlenstoffkosten.
Bewerten Sie die finanziellen Auswirkungen über Szenarien hinweg, auch wenn nur semi-quantitativ. Diese könnten Verschiebungen in Betriebskosten, Vermögenswerten oder neuen Einnahmequellen umfassen. Bewerten Sie dann, wie widerstandsfähig Ihre Gesamtstrategie in jedem Fall ist. Sie könnten feststellen, dass die Diversifizierung in kohlenstoffarme Produkte die Widerstandsfähigkeit in einer 2°C-Welt unterstützt, während physische Exposition die Widerstandsfähigkeit in einer 4°C-Welt schwächt.
Dokumentieren Sie klar die verwendeten Szenarien, getroffenen Annahmen, berücksichtigten Zeithorizonte und die Ergebnisse Ihrer Analyse. ISSB-konforme Offenlegungen sollten die strategischen Implikationen von Klimarisiken und wie Ihr Unternehmen sich anpassen könnte, zeigen. Verweisen Sie auf die TCFD-Leitlinien, die IFRS S2 untermauern, insbesondere auf die Aufforderung, die Widerstandsfähigkeit Ihrer Strategie in einem 2°C- oder niedrigeren Szenario zu beschreiben.
Szenarioanalysen können datenintensiv und ungewohnt sein, beginnen Sie also bei Bedarf einfach. Verwenden Sie bestehende Szenarien aus glaubwürdigen Quellen wie der IEA oder dem IPCC. Konzentrieren Sie sich auf wesentliche Klimavariablen für Ihren Sektor – zum Beispiel sollten Energieunternehmen Nachfrageänderungen betrachten, während die Landwirtschaft sich auf Niederschläge konzentrieren könnte.
Beteiligen Sie Stakeholder durch Workshops oder Expertenkonsultationen, um Auswirkungen zu bewerten. Selbst qualitative Analysen sind wertvoll, wenn Ihnen vollständige Modellierungskapazitäten fehlen. Achten Sie darauf, sowohl Übergangs- als auch physische Risiken zu bewerten.
Lassen Sie die Analyse die Strategie informieren: Wenn sie Schwachstellen aufzeigt, dokumentieren Sie geplante Anpassungen. Dies zeigt Investoren, dass Sie aktiv Klimarisiken managen. Das Ergebnis dieses Schritts wird zum Klimabereich Ihrer Strategieberichterstattung beitragen und zeigen, wie Sie Ihren Geschäftsansatz unter Klimabedingungen getestet und gestärkt haben.

Ein wichtiger (und herausfordernder) Schritt ist, Ihre wesentlichen Nachhaltigkeitsthemen in finanzielle Begriffe zu übersetzen. Investoren interessieren sich letztlich für Zahlen: Wie werden diese Nachhaltigkeitsrisiken oder -chancen Umsatz, Kosten, Vermögenswerte, Verbindlichkeiten oder den Zugang zu Kapital beeinflussen?
Führen Sie für jedes wesentliche Risiko und jede Chance eine Auswirkungsanalyse durch, um die aktuellen und zukünftigen finanziellen Effekte abzuschätzen. Wenn Sie beispielsweise ein Risiko von Lieferkettenunterbrechungen aufgrund von Klimaereignissen identifiziert haben, schätzen Sie ein, wie sich dies auf den Jahresumsatz auswirken oder zusätzliche Kosten verursachen könnte (z. B. „eine große Überschwemmung könnte 5 Millionen Dollar an Produktionsausfall kosten“). Wenn eine Chance darin besteht, eine neue grüne Produktlinie einzuführen, prognostizieren Sie den potenziellen Umsatz- oder Margenzuwachs. Dieser Schritt beinhaltet oft Szenarioausgaben (aus Schritt 4) und weitere Analysen durch Ihr Finanzteam.
Bewerten Sie für jedes wesentliche Nachhaltigkeitsrisiko oder jede Chance, wie es sich auf Ihre Finanzen auswirken könnte – Umsatz, Kosten, Vermögenswerte, Verbindlichkeiten oder den Zugang zu Kapital. Investoren möchten die finanzielle Bedeutung verstehen. Wenn klimabezogene Risiken in der Lieferkette identifiziert wurden, schätzen Sie die potenziellen Kosten von Unterbrechungen oder Produktionsausfällen ab. Wenn eine grüne Produktlinie eine Chance darstellt, prognostizieren Sie die erwarteten Umsatz- oder Margengewinne. Diese Schätzungen basieren oft auf den Ergebnissen Ihrer Szenarioanalyse in Schritt 4, kombiniert mit Beiträgen des Finanzteams.
Identifizieren Sie neben zukünftigen Projektionen auch Auswirkungen im aktuellen Zeitraum. Notieren Sie beispielsweise, ob extreme Wetterereignisse in diesem Jahr die Erträge beeinflusst haben oder ob die CO2-Bepreisung Ihre Betriebskosten erhöht hat. Berücksichtigen Sie auch bevorstehende Risiken für Ihre Finanzlage, wie potenzielle Wertminderungen von Vermögenswerten oder gestrandetem Kapital. Bewerten Sie, ob neue Nachhaltigkeitsvorschriften Verbindlichkeiten oder Rückstellungen einführen könnten. Dieser Schritt überschneidet sich mit dem Risikomanagement – denken Sie an Versicherungen, Rücklagen oder Kontrollmaßnahmen.
Die ISSB-Standards erkennen an, dass die finanzielle Quantifizierung schwierig sein kann. Wenn keine zuverlässigen Daten verfügbar sind, geben Sie eine klare qualitative Beschreibung ab. Wenn Sie keine genauen Zahlen zuweisen können, skizzieren Sie die wahrscheinliche Richtung und das relative Ausmaß der Auswirkungen – zum Beispiel eine wesentliche langfristige Kostensteigerung, aber geringe kurzfristige Effekte. Vermeiden Sie es, ein wesentliches Thema ohne irgendeine Form der finanziellen Interpretation zu lassen. Selbst qualitative Aussagen geben Investoren Einblick in Ihr Verständnis und Ihre Bereitschaft.
Beziehen Sie Ihr Finanz- und Risikomanagementteam ein, um Auswirkungen zu quantifizieren – dieser Schritt ähnelt oft dem Unternehmensrisikomanagement. Nutzen Sie vorhandene ERM-Modelle, Stresstests oder Versicherungsdaten. Priorisieren Sie die am besten messbaren und wesentlichen Punkte, wie CO2-Kosten, regulatorische Geldbußen oder Einnahmen aus grünen Produkten. Verwenden Sie Bereiche oder szenariobasierte Zahlen, um Unsicherheiten zu berücksichtigen.
Dies ist auch ein guter Zeitpunkt, um Risikokontrollen zu überprüfen und zu stärken: Stellen Sie sicher, dass jedes größere Risiko einen klaren Verantwortlichen und einen Minderungsplan hat. Wo betriebliche Änderungen oder interne Kontrollen erforderlich sind, beginnen Sie mit deren Umsetzung.
Diese Verbesserungen unterstützen die zukünftige Prüfungsbereitschaft (siehe Schritt 9). Durch die Quantifizierung und Kontextualisierung der Auswirkungen gewinnen Sie ein schärferes Verständnis dafür, welche Nachhaltigkeitsthemen finanziell wirklich von Bedeutung sind.
Die ISSB-Standards erfordern, dass Unternehmen spezifische Metriken und Indikatoren für ihre wesentlichen Nachhaltigkeitsthemen berichten – insbesondere im Bereich Klima. Dieser Schritt dreht sich um das Sammeln von Daten und die Berechnung der Metriken, die Sie offenlegen müssen.
Eine oberste Priorität für jede klimabezogene Offenlegung sind Treibhausgasemissionen (THG). IFRS S2 verlangt ausdrücklich die Offenlegung von Scope 1, Scope 2 und Scope 3 Emissionen, gemessen gemäß dem Greenhouse Gas Protocol.
Die ISSB-Standards, über IFRS S2, verlangen die Offenlegung von Treibhausgasemissionen über Scope 1 (direkte Emissionen), Scope 2 (gekaufter Strom) und Scope 3 (Wertschöpfungskette). Diese müssen gemäß dem Greenhouse Gas Protocol gemessen werden. Erstellen Sie ein vollständiges, aktuelles Inventar, das Ihr Geschäftsmodell widerspiegelt. Für Scope 3 konzentrieren Sie sich auf die relevantesten Kategorien – wie gekaufte Waren, Transport oder Geschäftsreisen. Schätzungen sind akzeptabel, und es ist in Ordnung, Lücken oder Auslassungen zu vermerken, insbesondere im ersten Jahr, da ISSB vorübergehende Erleichterungen für Scope 3 Offenlegungen zulässt.
Neben Emissionen identifizieren Sie geeignete Metriken für alle wesentlichen Nachhaltigkeitsrisiken und -chancen. IFRS S1 verlangt von Unternehmen, die Metriken offenzulegen, die das Management zur Überwachung jedes Themas verwendet. Wenn diese noch nicht definiert sind, verwenden Sie den empfohlenen Ansatz der ISSB, indem Sie sich auf die branchenspezifischen Standards von SASB beziehen. Zum Beispiel könnte Wasser Risiko durch Metriken wie Wasserentnahme verfolgt werden, während Arbeitssicherheit Verletzungsraten oder Schulungsstunden umfassen könnte. SASB, TCFD und GRI bieten hilfreiche Rahmenwerke, um glaubwürdige, investorenrelevante Metriken auszuwählen.
Sobald Metriken ausgewählt sind, beginnen Sie mit der Datenerfassung in allen Abteilungen. Dazu gehören Energiedaten für Emissionen, Beschaffungseingaben für Scope 3 und HR-Aufzeichnungen für Arbeitsmetriken. Wenden Sie konsistente Methoden an – zum Beispiel die Verwendung von Emissionsfaktoren aus dem GHG-Protokoll oder standardisierte Definitionen für HR-Indikatoren. Dokumentieren Sie alle verwendeten Annahmen oder Berechnungsmethoden. Validieren Sie die Daten durch Trendanalysen und Benchmarking, um die Genauigkeit sicherzustellen. Wenn Sie auf Datenlücken stoßen, legen Sie diese transparent offen und skizzieren Sie, wie Sie planen, sie in Zukunft zu schließen.
Nutzen Sie alle Tools oder Software, die Sie für die Datenerfassung haben – viele Unternehmen verwenden Nachhaltigkeitsplattformen oder Tabellenkalkulationen mit definierten Vorlagen. Das Aufteilen der Arbeit in kleinere Teile hilft: Energiemanager können Scope 1 und 2 Daten sammeln, die Beschaffung kann Teile von Scope 3 ansprechen, HR kann soziale Metriken bearbeiten, und so weiter.
Zentralisieren Sie die Daten anschließend. Erwägen Sie die Verwendung der SASB Materiality Map als Checkliste – sie hilft sicherzustellen, dass Sie sich an den Erwartungen der Investoren orientieren und vereinfacht interne Gespräche. Achten Sie auf Einheiten und Normalisierung: Während ISSB keine Intensitätsmetriken erfordert, bietet die Normalisierung (z. B. Emissionen pro Umsatzeinheit) nützlichen Kontext.
Intern kann das Zusammenstellen Ihrer Daten in einer KPI-Tabelle oder einem Dashboard die Entscheidungsfindung unterstützen und direkt in zukünftige Schritte wie Zielsetzung und Leistungstracking einfließen. Hochwertige Daten schaffen Vertrauen und bereiten Sie auf zukünftige Prüfungsanforderungen vor, selbst wenn diese noch nicht obligatorisch sind.
Die ISSB-Standards fordern Unternehmen auf, Ziele im Zusammenhang mit Nachhaltigkeitsrisiken und -chancen offenzulegen, insbesondere Klimaziele. Wenn Ihr Unternehmen öffentliche Ziele hat – zum Beispiel ein Netto-Null-Emissionsziel bis 2040, ein Ziel für die Nutzung erneuerbarer Energien oder ein Ziel für Vielfalt und Inklusion – müssen diese zusammen mit dem Fortschritt berichtet werden.
Beginnen Sie mit der Zusammenstellung aller aktuellen Nachhaltigkeitsziele, zu denen sich Ihr Unternehmen öffentlich verpflichtet hat – diese können sich auf Emissionen, Energie, Abfall, Vielfalt oder andere wesentliche Bereiche beziehen. Für jedes Ziel erfassen Sie wichtige Details wie das Basisjahr, das Zieljahr, den Umfang und das quantitative Ziel.
Zum Beispiel: „Reduzierung der Scope 1 und 2 THG-Emissionen bis 2030 um 50 % gegenüber dem Basisjahr 2019.“ Investoren und ISSB-Standards erwarten dieses Detailniveau zusammen mit einem Fortschrittsupdate basierend auf den neuesten verfügbaren Daten.
IFRS S2 erfordert die Offenlegung aller klimabezogenen Ziele – ob freiwillig oder gesetzlich vorgeschrieben – und der Metriken, die zur Messung des Fortschritts verwendet werden. Wenn Ihr Unternehmen noch keine Klimaziele festgelegt hat, erwägen Sie, mindestens eines zu erstellen, auch wenn es bescheiden oder qualitativ ist. Andernfalls muss Ihr ISSB-Bericht angeben, dass keine Ziele existieren, was bei Investoren Bedenken hervorrufen könnte. Einige Unternehmen orientieren sich an wissenschaftlich basierten Zielen (SBTi) oder nationalen Zielen, tun dies jedoch nur, wenn Sie das Engagement mit einem glaubwürdigen Umsetzungsplan untermauern können.
Obwohl die ISSB nicht verlangt, dass Unternehmen neue Ziele über das Klima hinaus setzen, erfordert sie die Offenlegung aller bestehenden. Für jedes wesentliche Thema – wie Wasserverbrauch, Sicherheit oder Kreislaufwirtschaft – bewerten Sie, ob ein formales Ziel helfen würde, zu demonstrieren, dass das Risiko oder die Chance proaktiv gemanagt wird. Wenn neue Ziele gesetzt werden, stellen Sie sicher, dass sie realistisch, messbar und durch Aktionspläne unterstützt sind. Verknüpfen Sie jedes Ziel mit spezifischen Metriken, die in Schritt 6 identifiziert wurden, um eine konsistente Verfolgung sicherzustellen.
Präsentieren Sie Ihre Ziele in einem klaren Tabellenformat, das die Metrik, den Basiswert und das Jahr, den Zielwert und das Jahr sowie den neuesten Leistungsstatus zeigt. Für Klimaziele geben Sie an, ob das Ziel absolut oder intensivitätsbasiert ist und welche Emissionsbereiche (1, 2 und/oder 3) einbezogen sind. Viele Unternehmen enthalten auch eine Zusammenfassung der Strategie zur Erreichung jedes Ziels – zum Beispiel „Netto-Null bis 2040, zu erreichen durch Energieeffizienz, Flottenelektrifizierung und CO2-Kompensationen.“ Wenn Sie keine formalen Ziele haben, können Sie interne Benchmarks offenlegen, wie einen internen CO2-Preis oder eine Risikoschwelle.
Jetzt ist es an der Zeit, Ihre ISSB-konforme Offenlegung zusammenzustellen und zu strukturieren. Sowohl IFRS S1 als auch S2 folgen der klassischen TCFD-Struktur von vier Kerninhaltsbereichen: Governance, Strategie, Risikomanagement und Metriken & Ziele. Die Organisation Ihres Berichts (oder Berichtabschnitts) um diese Säulen stellt sicher, dass Sie alle Offenlegungsanforderungen in einem logischen Ablauf erfüllen. So gehen Sie vor:
Beschreiben Sie, wie Ihr Unternehmen Nachhaltigkeitsthemen steuert. Dazu gehört die Rolle des Vorstands (z. B. welches Komitee die Nachhaltigkeit überwacht, wie oft sie besprochen wird und die Expertise des Vorstands) und die Rolle des Managements (z. B. Vorhandensein eines Chief Sustainability Officer oder ESG-Komitees). Klären Sie, wie die Aufsicht ausgeübt wird und wer verantwortlich ist. Dieser Abschnitt sollte beantworten: „Wer ist verantwortlich und wie werden Risiken und Chancen gesteuert?“
Dieser Abschnitt sollte Ihre Analyse aus den Schritten 1–5 integrieren. Fassen Sie die identifizierten wesentlichen Risiken und Chancen zusammen und erklären Sie, wie sie Ihr Geschäftsmodell, Ihre Strategie und Ihre Finanzplanung beeinflussen. Schließen Sie Ergebnisse Ihrer Klimaszenarioanalyse ein, die zeigen, wie Ihre Strategie unter verschiedenen Klimafutures (wie einem 2°C-Szenario) abschneidet. Diskutieren Sie auch Ihre Übergangspläne und strategischen Reaktionen auf Nachhaltigkeitsrisiken. Präsentieren Sie sowohl aktuelle als auch erwartete finanzielle Auswirkungen klar.
Skizzieren Sie Ihren Prozess zur Identifizierung, Bewertung und Verwaltung von nachhaltigkeitsbezogenen Risiken. Zeigen Sie, wie diese Risiken in Ihr umfassenderes Unternehmensrisikomanagementsystem integriert sind. Erklären Sie beispielsweise, wie oft Risiken überprüft werden, wie sie priorisiert werden und welche Minderungsmaßnahmen vorhanden sind. Wenn Sie während dieser Arbeit neue Kontrollen oder Eskalationsprozesse eingeführt haben, beschreiben Sie diese kurz. Dieser Abschnitt stärkt das Vertrauen der Investoren in Ihre internen Prozesse.
Präsentieren Sie die wichtigsten quantitativen Offenlegungen aus den Schritten 6 und 7. Schließen Sie Ihr THG-Inventar (Scopes 1, 2, 3) sowie alle branchenspezifischen Metriken ein, die mit Ihren wesentlichen Themen verbunden sind. Geben Sie aktuelle Werte, Vergleiche mit Vorjahren und alle Ziele sowie den Fortschritt zu deren Erreichung an. Eine einfache Tabelle funktioniert gut dafür. Erklären Sie auch Ihre Messmethoden (z. B. Verwendung des GHG-Protokolls) und vermerken Sie, ob Daten verifiziert oder geprüft wurden. Konzentrieren Sie sich auf wesentliche Metriken und verwenden Sie visuelle Darstellungen wie Diagramme, wo hilfreich.
Ordnen Sie jede IFRS S1 und S2 Anforderung dem entsprechenden Abschnitt Ihres Berichts in einer Checkliste oder Gliederung zu, um eine vollständige Abdeckung sicherzustellen. Dies ist besonders nützlich, um auf spezifische IFRS-Absatznummern zu verweisen.
Stellen Sie sicher, dass der Bericht mit Ihren Finanzoffenlegungen verbunden ist – zum Beispiel, wenn Klimaauswirkungen im Strategieabschnitt diskutiert werden, sollten entsprechende finanzielle Anmerkungen diese widerspiegeln.
Lassen Sie schließlich jemanden außerhalb des Entwurfsteams die Struktur auf Klarheit überprüfen. Das Ziel ist nicht nur die Einhaltung, sondern ein entscheidungsnützlicher Bericht, der klar mit Investoren kommuniziert. Ein gut strukturierter Bericht legt auch die Grundlage für Ihren nächsten Berichtszyklus und unterstützt einen reibungslosen Abschluss Ihrer ISSB-Implementierung.
Da die Nachhaltigkeitsberichterstattung reift, wird die Prüfung zur Norm. Während die ISSB-Standards selbst nicht verlangen, dass Sie eine Prüfung Ihrer Offenlegungen erhalten, sind sie so konzipiert, dass sie prüfbar sind – und viele Gerichtsbarkeiten und Interessengruppen bewegen sich in diese Richtung.
Selbst wenn es noch nicht obligatorisch ist, kann das freiwillige Einholen einer Prüfung die Glaubwürdigkeit und Vertrauenswürdigkeit Ihrer Nachhaltigkeitsberichterstattung erheblich stärken. Es signalisiert Investoren und anderen Interessengruppen, dass Ihr Unternehmen Nachhaltigkeitsdaten genauso ernst nimmt wie Finanzinformationen. Dieser Schritt konzentriert sich darauf, Ihre Daten, Dokumentation und Prozesse prüfbereit zu machen.
Beginnen Sie damit, festzustellen, welche Offenlegungen wahrscheinlich in den Prüfungsumfang fallen – in der Regel quantitative Metriken wie THG-Emissionen, Energie- und Wasserverbrauch sowie alle Ansprüche oder Ziele. Markieren Sie diese Punkte in Ihrem Bericht und stellen Sie sicher, dass jeder eine klare Prüfspur hat, einschließlich Quelldaten, verantwortlicher Mitwirkender und Berechnungsmethoden.
Bewerten Sie die internen Kontrollen, die Sie für Nachhaltigkeitsdaten haben. Diese sollten, wo möglich, den Finanzberichterstattungsprozessen ähneln, wie z. B. Zweitprüfungen, Validierungsprüfungen und Abteilungsfreigaben. Füllen Sie alle Lücken. Wenn beispielsweise Scope 3 Daten informell gesammelt wurden, formalisieren Sie den Prozess mit standardisierten Vorlagen und einem Überprüfungsprotokoll. Für komplexe Metriken oder Berechnungen bereiten Sie prägnante Methodiknotizen vor, um zu erklären, wie Werte abgeleitet wurden.
Sammeln Sie Dokumentationen, um jede wesentliche Behauptung oder jedes Ziel zu unterstützen. Wenn Sie „100 % erneuerbaren Strom“ angeben, belegen Sie dies mit Zertifikaten oder Rechnungen. Wenn Sie die Verwendung eines internen CO2-Preises erwähnen, stellen Sie Richtliniendokumente oder Protokolle des Vorstands bereit. Gehen Sie davon aus, dass jede wesentliche Offenlegung mit „beweisen Sie es“ herausgefordert wird – und bereiten Sie sich entsprechend vor. Das Erstellen von Beweispaketen unterstützt nicht nur die Prüfung, sondern verbessert auch das interne Datenvertrauen.
Führen Sie ein Probeaudit oder eine Verifizierung mit interner Revision oder einem externen Berater durch. Dies wird frühzeitig Probleme aufzeigen und Ihnen helfen, sie zu beheben, bevor Sie sich einer formalen Prüfung stellen. Es gibt Ihrem Team auch ein Gefühl dafür, was zu erwarten ist, und verbessert die Bereitschaft für zukünftige regulatorische Änderungen.
Wenn Ihr Unternehmen bereits einen Finanzprüfungsprozess hat, beziehen Sie dieses Team ein oder übernehmen Sie deren Ansatz, um Hochrisiko- oder wesentliche Daten zu kennzeichnen. Schulen Sie Finanz- und Prüfungsmitarbeiter zu Nachhaltigkeitsthemen oder holen Sie bei Bedarf Spezialisten hinzu.
Seien Sie offen über alle Einschränkungen in Ihren Offenlegungen – Transparenz schafft Vertrauen. Geben Sie beispielsweise an, wann bestimmte Scope 3 Kategorien auf Schätzungen beruhen oder wann Primärdaten fehlen. Prüfungsanbieter bevorzugen solche offenen Offenlegungen, da sie Bewusstsein und Engagement für Verbesserungen zeigen.
Die Vorbereitung auf eine begrenzte Prüfung sichert nicht nur Ihre Berichterstattung für die Zukunft, sondern erhöht auch die Glaubwürdigkeit und das Vertrauen der Investoren in Ihre ISSB-Offenlegungen – selbst bevor die Prüfung obligatorisch wird.
Erwägen Sie schließlich eine externe Überprüfung und Feedbackschleife zu Ihrer ISSB-Offenlegung vor und nach ihrer Veröffentlichung. Obwohl ISSB-Berichte investorenorientiert sind, kann die Perspektive von Stakeholdern wie Investoren, Analysten, Vorstandsmitgliedern oder sogar NGOs von unschätzbarem Wert sein, um Ihre Berichterstattung zu verfeinern.
Obwohl ISSB-Offenlegungen investorenorientiert sind, kann das Feedback einer ausgewählten Gruppe von Stakeholdern – wie Investoren, ESG-Analysten, Vorstandsmitgliedern oder NGOs – die Qualität und Nützlichkeit Ihres Berichts erheblich verbessern. Erwägen Sie, einen fast fertigen Entwurf (ohne vertrauliche Abschnitte) unter NDA mit einem kleinen Überprüfungsgremium zu teilen. Stellen Sie Leitfragen bereit, um ihr Feedback zu lenken, z. B. ob etwas unklar oder fehlend ist, ob Metriken gut präsentiert sind oder ob die Erzählung zu technisch ist. Dieser strukturierte Ansatz kann helfen, Lücken oder Klarheitsprobleme zu identifizieren, bevor Ihr Bericht veröffentlicht wird.
Ihr Vorstand sollte den Entwurf des Berichts überprüfen, um sicherzustellen, dass er mit ihrem Verständnis der Unternehmensstrategie und -risiken übereinstimmt. Wenn Ihr Bericht Teil Ihres Jahresberichts ist, kann diese Überprüfung erforderlich sein. Wenn Sie sich auf eine Prüfung vorbereitet haben (Schritt 9), beziehen Sie auch Ihre Prüfungsanbieter ein – sie können Verbesserungsvorschläge zur Klarheit machen oder fehlende Dokumentationen hervorheben.
Bleiben Sie nach der Veröffentlichung offen für Fragen und Feedback von Investoren, ESG-Ratingagenturen oder anderen Stakeholdern. Erwägen Sie die Einrichtung eines dedizierten Feedback-Kanals, z. B. einer E-Mail oder Umfrage. Behandeln Sie dieses Feedback als wertvollen Input für Ihren nächsten Berichtszyklus. Das Schließen des Kreislaufs hilft, die Klarheit und Relevanz Ihres Berichts zu verbessern und zeigt gleichzeitig Engagement für Transparenz und kontinuierliche Verbesserung.
Wenn Sie Entwürfe extern teilen, seien Sie klar über Vertraulichkeit und Zweck – konzentrieren Sie die Prüfer auf wesentliche Themen, nicht auf Textkorrekturen. Dokumentieren Sie das erhaltene Feedback und Ihre Entscheidungen, ob Sie darauf reagieren. Wenn bestimmte Vorschläge im aktuellen Zyklus nicht umsetzbar sind, notieren Sie sie für das nächste Jahr.
Lassen Sie die Prüfer wissen, wie ihr Input den endgültigen Bericht beeinflusst hat – es baut Wohlwollen auf und zeigt Wertschätzung. Nutzen Sie Überprüfungsdiskussionen als Gelegenheit, wichtige Stakeholder über Ihre Nachhaltigkeitsbemühungen aufzuklären.
Indem Sie diese zehn Schritte befolgen, können Unternehmen die ISSB-Berichterstattung auf methodische und effektive Weise angehen. Von der Identifizierung dessen, was wirklich wichtig ist, über die Einbettung in die Strategie bis hin zur korrekten Zahlen- und Erzählweise baut jeder Schritt auf eine umfassende Nachhaltigkeitsoffenlegung auf, die den globalen Erwartungen der Investoren entspricht.
Nachhaltigkeits-, Betriebs- und Finanzteams müssen während des gesamten Prozesses zusammenarbeiten – was an sich ein positives Ergebnis ist, da es die Trennung zwischen ESG und Finanzen aufbricht. Das Endergebnis sollte ein ISSB-konformer Bericht sein, der nicht nur den Standards entspricht, sondern auch Entscheidungsträgern echte Informationen liefert.
Denken Sie daran, dass die ISSB-Berichterstattung eine Reise der kontinuierlichen Verbesserung ist. Mit jedem Berichtszyklus wird der Prozess reibungsloser: Die Datenqualität wird sich verbessern, das interne Bewusstsein wird wachsen und die strategische Ausrichtung wird sich vertiefen.





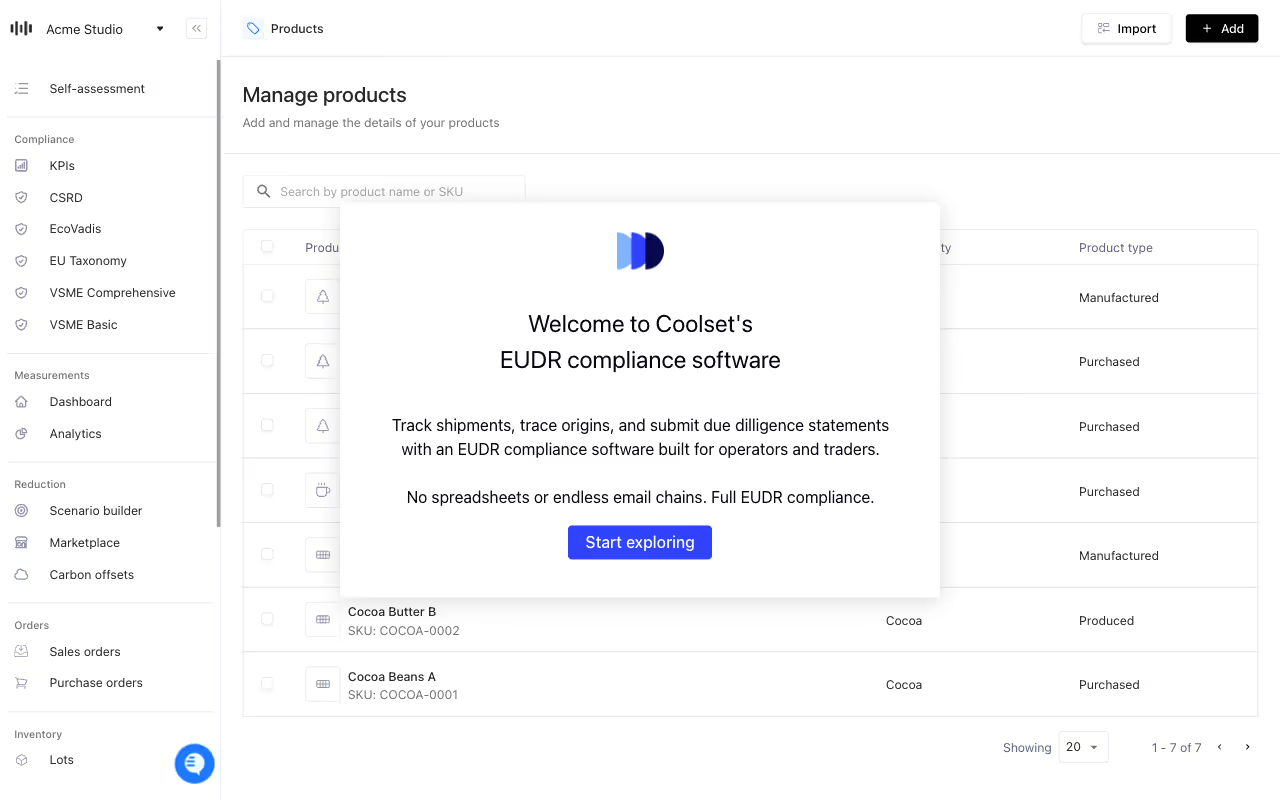
This free compliance checker scans your packaging documentation and maps it against mandatory PPWR data requirements, giving you a clear view of your compliance status. Get actionable insights on documentation gaps before they become compliance issues.
Based on customer case studies our team has developed a realistic timeline and planning for EUDR compliance. Access it here.